von Sonja Dolinsek
In den letzten Tagen sorgt Belgiens neues Prostitutionsgesetz für Schlagzeilen. Es eröffnet die Möglichkeit, Arbeitsverträge für Sexarbeitende abzuschließen und gewährt ihnen damit Rechte, die in vielen anderen Branchen selbstverständlich sind – wie etwa Mutterschutz. Oft wird dabei behauptet, Belgien sei das erste Land, das diesen Schritt wagt. Doch das ist nicht ganz korrekt, um nicht zu sagen, falsch. Bereits seit 2002 sind in Deutschland Anstellungsverhältnisse für Sexarbeitende möglich. Damit verbunden sind Rechte wie Kranken- und Rentenversicherung, Mutterschutz und Sozialversicherung. Auch in der Schweiz können Sexarbeitende Arbeitsverträge eingehen.
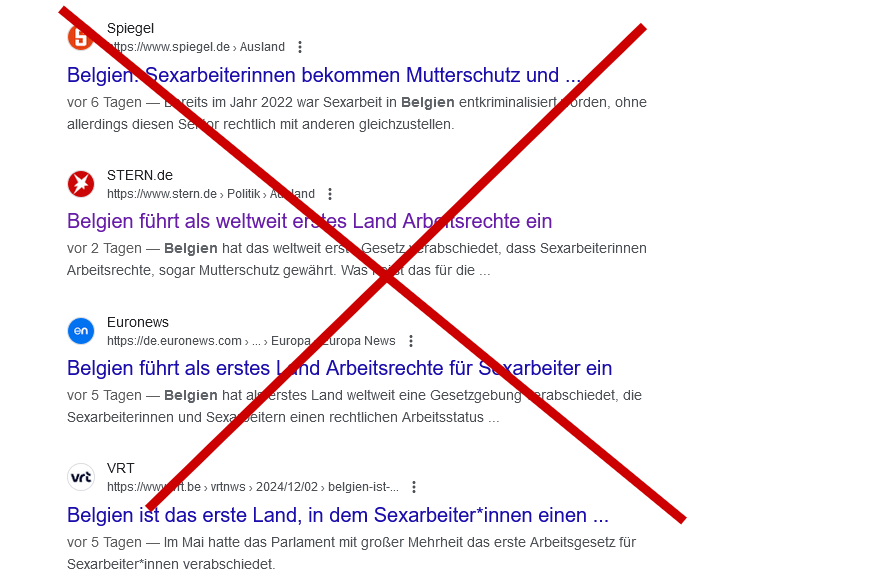
Allerdings zeigt die deutsche Erfahrung, dass diese Möglichkeiten bislang nur eingeschränkt genutzt werden. Es gibt nur wenige Sexarbeitende, die sich anstellen lassen, und noch seltener bieten Bordellbetreiber entsprechende Verträge an. Üblicher ist es, dass Sexarbeitende sich als Selbständige für meist nur einen kurzen Zeitraum einmieten und dann weiterziehen. Zuletzt waren es in ganz Deutschland weniger als 100. Warum das so ist, bleibt weitgehend ungeklärt. Eine mögliche Erklärung könnte in den spezifischen Anforderungen der Sexarbeit liegen, die oft eine hohe räumliche und zeitliche Flexibilität erfordern – Anforderungen, die sich mit einem klassischen Angestelltenverhältnis nur schwer vereinbaren lassen. Solche Hypothesen sind jedoch bislang kaum wissenschaftlich untersucht – eine von vielen Forschungslücken.
Mit der Reform, die in Belgien am 1. Juni 2022 in Kraft trat, wurde Sexarbeit aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, wie das belgische Justizministerium erklärt. Damit endet eine Ära rechtlicher Grauzonen, in denen Sexarbeit zwar geduldet, aber nicht reguliert wurde – eine Rechtslage, die mit Deutschland vor 2002 vergleichbar ist. Vor der Reform konnten beispielsweise Menschen, die mit Sexarbeitenden zusammenarbeiteten – etwa als Fahrer*innen oder Buchhalter*innen –, strafrechtlich belangt werden. Zudem hatten viele Sexarbeitende kaum Zugang zu Krediten oder Hypotheken. Die Corona-Pandemie hat die Dringlichkeit solcher Regelungen verdeutlicht, da zahlreiche Sexarbeitende ohne soziale Absicherung zurückblieben und keine staatliche Unterstützung erhielten.
Ab dem 1. Dezember 2024 sind in Belgien Arbeitsverträge für Sexarbeitende möglich. Diese Verträge gehen über allgemeine arbeitsrechtliche Standards hinaus: Sie berücksichtigen die besonderen Anforderungen und Risiken der Sexarbeit. Wichtige Rechte, wie das jederzeitige Ablehnen von Kund*innen oder Handlungen sowie das Abbrechen von Interaktionen, bleiben vollständig in den Händen der Betroffenen. Diese Rechte sind nicht verhandelbar, und Verstöße durch Arbeitgeber*innen werden verfolgt.
Die Gesetzgebung in Belgien stellt sicher, dass nur zugelassene Arbeitgeber*innen solche Arbeitsverhältnisse anbieten dürfen. Die Zulassung unterliegt strengen Kriterien, um unregulierte Beschäftigung und Scheinselbstständigkeit zu verhindern. Zudem bietet dieses Modell Schutz vor Ausbeutung und wahrt die Selbstbestimmung der Arbeitenden. Unklar bleibt allerdings noch, welche Auflagen diese Arbeitgeber*innen konkret erfüllen müssen – auch hier wäre ein Vergleich zu Deutschland spannend.
Gleichwohl bleibt offen, ob und inwiefern in Belgien die Möglichkeit, Arbeitsverträge abzuschließen, tatsächlich von Sexarbeitenden angenommen wird. Ebenso ist unklar, wie diese Reform in der Praxis umgesetzt werden kann, insbesondere in Bezug auf die Bedingungen für selbstständiges Arbeiten. Die Sorge, die Sexarbeiterin Fabienne Freymadl äußerte, dass selbstständige Sexarbeitende möglicherweise keine Arbeitsorte zur Verfügung gestellt bekommen, scheint allerdings unbegründet. Der rechtliche Rahmen in Belgien sieht ausdrücklich vor, dass selbstständige Sexarbeit erlaubt ist, solange keine Organisation der Prostitution anderer Personen stattfindet. Dies bedeutet, dass Sexarbeitende eigenständig arbeiten und auch gemeinsam Arbeitsräume nutzen können, ohne dabei in Konflikt mit dem Gesetz zu geraten – vorausgesetzt, jede*r bleibt vollständig unabhängig und es entstehen keine ausbeuterischen Strukturen.
Die Möglichkeit, Arbeitsorte zu mieten oder zu teilen, wird somit durch das Gesetz nicht eingeschränkt, solange keine dominante oder kontrollierende Partei involviert ist. Diese Offenheit für selbstständige Arbeitsmodelle könnte dazu beitragen, Belgien zu einem Vorbild für andere Länder zu machen, da es sowohl Schutz als auch Flexibilität für Sexarbeitende bietet. Dennoch bleibt abzuwarten, wie diese Regelungen in der Praxis angewandt und überwacht werden, um Missbrauch und rechtliche Unsicherheiten zu vermeiden.
Für Deutschland könnte dieses Modell wegweisend sein. Trotz der seit 2002 bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten wird die Option eines Angestelltenverhältnisses in der Sexarbeit kaum genutzt. Es mangelt an Arbeitgeber*innen, die solche Verträge anbieten, und an einem rechtlichen Rahmen, der diese Beschäftigungsform gezielt fördert. Belgien zeigt, wie klare Regeln und der Fokus auf Rechte statt Kontrolle eine bessere Umsetzung ermöglichen könnten.
Ein wesentlicher Unterschied zwischen Deutschland und Belgien betrifft die Zugangshürden zur tatsächlichen Ausübung der legalen Sexarbeit. Während Deutschland mit Maßnahmen wie dem „Hurenpass“ und Sperrgebieten unnötige und stigmatisierende Hürden schafft, verzichtet Belgien auf solche Instrumente. Sexarbeitende können dort reguläre Arbeits- oder Selbstständigenverhältnisse eingehen, ohne zusätzliche Sonderregistrierungen oder Auflagen. Diese Praktiken in Deutschland schaffen einen Doppelstandard, der viele Sexarbeitende in rechtliche Grauzonen drängt, wo sie weniger Schutz genießen und einem höheren Risiko von Gewalt oder Ausbeutung ausgesetzt sind. Außerdem stellen Sperrbezirksverordnungen und der damit zusammenhängende Paragraph im Strafgesetzbuch „Verbotene Prostitution“ eine anhaltende Form der Kriminalisierung dar.
Natürlich verfolgt auch Belgien, wie Deutschland auch, Straftaten wie Menschenhandel oder Ausbeutung – und das zu Recht. Doch im Gegensatz zu Deutschland verzichtet Belgien auf Maßnahmen, die die Selbstbestimmungsrechte der Sexarbeitenden einschränken oder ihre Arbeit kriminalisieren. Diese progressive Herangehensweise zeigt, wie Gesetze Schutz statt Kontrolle in den Mittelpunkt stellen können.
Die belgische Reform ist ein Beispiel dafür, wie Sexarbeit als Beruf anerkannt werden kann, ohne die Rechte der Betroffenen zu beschneiden oder sie zu stigmatisieren. Statt über eine Hinwendung zum sogenannten „Nordischen Modell“ nachzudenken, das Kund*innen kriminalisiert und Sexarbeit in illegale Strukturen und Arbeitsorte treibt, könnte Deutschland von Belgien lernen. Studien zeigen, dass Verbote nicht zu mehr Sicherheit führen, sondern Sexarbeitende isolieren und ihre Situation verschlechtern.
Belgien zeigt, wie eine moderne, menschenrechtszentrierte Prostitutionspolitik aussehen kann. Es bleibt zu hoffen, dass Deutschland diesen Impuls aufgreift und seine Gesetzgebung in diese Richtung weiterentwickelt, die Rechte und Selbstbestimmung stärkt – statt sie durch rückschrittliche Maßnahmen zu untergraben. Die Zukunft liegt in der Anerkennung von Sexarbeit, nicht in ihrer Ächtung und Illegalisierung! Eine Debatte, wie die Bedingungen legaler Sexarbeit verbessert werden können, ist längst überfällig. Wir sollten nicht mehr über Verbote reden, vor allem nicht mehr über sogenannte „Sexkaufverbote“, sondern konstruktiv und fokussiert darüber, wie wir die aktuellen Rahmenbedingungen für legale Sexarbeit weiterentwickeln können.
Weitere Links:
UTSOPI (Belgische Sexworker-Organisation): https://www.utsopi.be/
Hinterlasse eine Antwort zu Karl Mallinger Antwort abbrechen